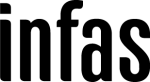In Berlin sprach Jacob Steinwede mit Hans-Dieter Klingemann über politische Antworten auf die Herausforderungen des gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Eine klassische westlichliberale Antwort auf die Herausforderungen des gesellschaftlichen Zusammenhalts wurde mit dem Begriff Verfassungspatriotismus umschrieben. Gegenwärtig wird allerdings ein Zerbröckeln des Westens konstatiert. Es heißt, der Zweifel an unseren Institutionen und an den politischen Eliten wachse. Ist das eine ernste Gefahr?
Wenn man diese Frage analytisch angehen will, dann fällt mir immer die Taxonomie von David Easton ein. Easton hat unterschieden zwischen der politischen Gemeinschaft (political community), dem verfassten politischen Regime (political regime) und den politischen Akteuren (political authorities). Easton hat sinngemäß gesagt, man müsse die Frage nach dem Zusammenhalt und nach der Unterstützung der politischen Gemeinschaft, des politischen Regimes und der politischen Akteure immer jeweils auf der richtigen Ebene stellen. Deutschland hat unterschiedliche politische Regime etabliert, so das Kaiserreich, die demokratisch verfasste Weimarer Republik, die nationalsozialistische Diktatur des Dritten Reichs, die kommunistische Diktatur der DDR und die demokratische Bundesrepublik. Es waren also unterschiedlich verfasste politische Regime mit der deutschen Community kompatibel. Easton sagt: Blickt darauf, welche politischen Entscheidungen getroffen werden. Und beobachtet, wann die Bürger anfangen, Entscheidungen von der Akteursebene loszulösen und mit der Regime-Ebene zu verbinden. Das bedeutet: Wenn auf eine gewisse Dauer die Entscheidungen der politischen Eliten nicht die gesellschaftlichen Probleme lösen, dann sagen die Leute nicht mehr, die CDU-Regierung ist aber schlecht, jetzt müssen wir eben die SPD wählen, sondern sie sagen, die Demokratie ist nicht die richtige Organisationsform, um die Bedürfnisse nach Sicherheit, Wohlstand und kulturellem Leben zu gewährleisten. Die Frage ist, wann die Bürger das sagen. Dass es nicht mehr das Wechselspiel von Regierung und Opposition, sondern dass es das ganze System ist, das schlecht ist, weil es die Erfolge nicht liefert.
Zur Person:
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Dieter Klingemann, Jahrgang 1937, ist ein Nestor der deutschen und internationalen Politikwissenschaft.
Klingemann war unter anderem von 1974 bis 1980 Wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA), Mannheim; von 1980 bis 2002 war er als Professor für Politische Wissenschaft an der Freien Universität Berlin und zwischen 1989 und 2003 als Direktor der Abteilung „Institutionen und sozialer Wandel“ am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) tätig. 2011 wurde er mit dem Lifetime Achievement Award durch das European Consortium for Political Research (ECPR) ausgezeichnet. Nach langjähriger internationaler Lehr- und Forschungstätigkeit ist Hans-Dieter Klingemann derzeit Präsident der Berlin International University of Applied Sciences.
Aber an dem Punkt sind wir nicht?
An dem Punkt sind wir nicht. Ich habe gerade eine aktuelle Analyse erstellt mit der Frage, wie stark das Commitment zu demokratischen Werten bei unseren Parlamentariern und bei der Bevölkerung ausgeprägt ist. Und da sind es bei den politischen Eliten, also bei den Parlamentariern, für Werte wie Freiheit, Gleichheit und so weiter, fast 100 Prozent. In der Bevölkerung ist das auf einem Niveau von über 80 Prozent der Fall. Bei der AfD liegt der Anteil bei 70 Prozent. Es ist also nicht so, dass man auf der Werte-Ebene sagen muss, Deutschland leide an mangelnder Unterstützung der Demokratie als Regierungsform. Wenn man jetzt auf die Regime-Ebene geht – das heißt, wenn man fragt, wie zufrieden man mit der Art und Weise ist, wie unser demokratisches System funktioniert –, dann ist die Unterstützung zwar geringer. Sie liegt aber immer noch in der Größenordnung von zwei Drittel. Es sind mindestens zwei Drittel der Bevölkerung, die sagen: Wir haben ein gutes politisches System, das funktioniert gut. Und dann kommt hinzu, dass man dabei bedenken muss, dass unter denjenigen, die sagen, dass es nicht gut funktioniert, zum großen Teil auch Leute sind, die sagen, die demokratischen Werte müssten eigentlich noch stärker in unseren Institutionen zur Geltung kommen. Das ist das Phänomen der unzufriedenen Demokraten. Es ist also nicht so, dass in einer etwas geringeren Unterstützung unseres demokratischen Regimes zum Ausdruck kommt, dass man lieber eine Autokratie haben will.
In welcher Größenordnung haben wir unzufriedene Demokraten?
Also, Pippa Norris hat das Thema der unzufriedenen Demokraten auf die Forschungsagenda gesetzt und auch ich habe dazu größere Analysen gemacht. Was die Unterstützung der politischen Akteure angeht, so habe ich in meiner letzten Analyse gefunden, dass eine generalisierte Unterstützung von politischen Parteien viel niedriger ist als die Unterstützung demokratischer Werte oder die Unterstützung des demokratischen Regimes unserer Bundesrepublik. Sie liegt aber, was die Bevölkerung angeht, immer noch in einer Größenordnung von zwischen 20 und 25 Prozent. Und das genügt offensichtlich, dass Bürger bei Wahlen, wenn sie mit ihrer eigenen Partei unzufrieden sind, dann doch noch eine andere finden, die sie wählen können. Das Phänomen ist ja interessant. Wenn man die Leute fragt „Hier haben Sie die fünf oder sechs Parteien in Deutschland, wie sympathisch sind die Ihnen denn?“, dann ist mit hundertprozentiger Sicherheit das Resultat, dass den Bürgern mindestens zwei, drei von diesen fünf oder sechs Parteien sehr oder relativ sympathisch sind, dass sie sich also auf einer Sympathieskala in den oberen Rängen befinden. Die generalisierte Unterstützung von politischen Parteien als Akteuren liegt aber auf niedrigerem Niveau als die Unterstützung demokratischer Werte oder unseres demokratischen Regimes.
Wer ist eigentlich für das eigene Leben verantwortlich: Bin ich das selbst oder ist es der Staat?
Das kommt dadurch zustande, dass man bei der generalisierten Bewertung immer an die gegnerischen politischen Parteien denkt. Dass eine generalisierte Parteienunterstützung niedrig ist, greifen viele pessimistische Kommentatoren auf. Aber sie bedenken eben diesen Unterschied nicht, den Unterschied zwischen der spezifischen, in der Regel positiven, Parteisympathie und der, in der Regel eher negativen, generalisierten Beurteilung der politischen Parteien.
Derzeit findet die These Verbreitung, das liberale Verfassungsprinzip müsse mit kultureller Identität unterfüttert werden, um tragfähig zu sein. Der Begriff Heimat wird als konservative Antwort jetzt stärker geführt, vormals sprach man von Leitkultur.
Es geht doch um die politische Gemeinschaft und um die Frage, welche Werte in politischen Regimen institutionalisiert werden. Das drückt sich in der Regel konkret in den Verfassungsnormen aus. Und die Normen der Verfassung müssen durch Werte legitimiert werden. Dieser spezifische Set von Werten kann als allgemeiner Bezugspunkt für die politische Gemeinschaft und das politische Regime bestimmt werden.
Das ist nahe an dem argumentiert, was unter Verfassungspatriotismus verstanden wird …
Ja, aber man kann und muss das natürlich noch weiter spezifizieren. Mein Kollege Dieter Fuchs und ich haben eine Taxonomie über unterschiedliche Demokratieverständnisse entwickelt. Die läuft darauf hinaus, dass man erstens fragt, wer denn eigentlich für das eigene Leben verantwortlich ist: Bin ich das selber oder ist es der Staat? Und dass man zweitens fragt, welche Regeln für das Zusammenleben der Menschen gelten sollen: Kooperation oder Wettbewerb? Die Kombination ergibt eine 4-Felder-Tafel. Erstens also: Ich bin verantwortlich und nicht der Staat und es soll Wettbewerb herrschen. Das kennzeichnet ein neoliberales Demokratieverständnis, das etwa Hajek beschrieben hat. Sagt man hingegen „Eigenverantwortung und Staat“, dann hat man eine zweite Kombination, die vielleicht als sozialdemokratische Demokratievorstellung bezeichnet werden könnte. Der Staat muss hier in erster Linie die „equality of opportunity“ sichern. Das heißt, wir brauchen den Staat, um zu garantieren, dass jeder die gleichen Wettbewerbschancen hat, das geht nicht über den Markt alleine. Hier denkt man an John Rawls. Und wenn eine dritte Kombination besagt, nicht der Staat ist verantwortlich, sondern ich selbst, es sollte aber auch Solidarität herrschen, dann sind wir bei den republikanischen Vorstellungen von Demokratie, nahe am Kommunitarismus. Ich kenne jemanden, eine der wenigen Personen im akademischen Bereich, die als Republikanerin gelten kann. Die hat gesagt: „Wir brauchen keinen Sozialstaat, das machen wir selber. Wir sind hier in unserer Gemeinde und haben hier bedürftige Leute. Und wer muss sich darum kümmern? Das müssen wir selbst tun.“ Das beschreibt diese Einstellung gut: Ich bin verantwortlich und will Solidarität haben. Und dann ist da noch die letzte Kombination. Sie ist einfach zu verstehen: Solidarität und der Staat sind verantwortlich. Das ist eine typisch sozialistisch-kommunistisch orientierte Vorstellung von Demokratie. Vor diesem Hintergrund kann man also sagen: Aus den jeweiligen Normen, die man mit unterschiedlichen demokratischen Werten legitimieren kann, folgen also etwa ein neoliberales, ein sozialdemokratisches, ein republikanisches oder ein sozialistisches Regime. Und solche unterschiedlich verfassten Regime erwarten natürlich im Alltag ein jeweils anderes Verhalten der Bürger. Wie etwa, dass man sich sein Auto schnappt und den bedürftigen Nachbarn das Essen hinfährt. So weit sind die in den Verfassungen etablierten Werte und Normen von den daraus ableitbaren Handlungen gar nicht entfernt. Klar, nicht jeder liest die Verfassung! Aber wenn wir die Werte mal auflisten würden, die in den verschiedenen Verfassungen benutzt werden, um die Regeln zu legitimieren, dann können wir Normen benennen und fragen: Bestimmen die denn auch das Leben in der Gesellschaft? So, dass wir die Nähe oder Ferne dessen, was da auf dem Papier steht, von der Realität des Alltagslebens bestimmen können. Und dann könnten wir sagen: Ja, Verfassungspatriotismus, den haben wir vielleicht. Aber er ist eben auf die Werte und Normen der Verfassung konkret zu beziehen. Ich würde dazu nicht Leitkultur sagen. Aber dass sich eine politische Gemeinschaft eine Verfassung gibt und den schwierigen Prozess der Auswahl bestimmter Werte zur Legitimierung der Verfassungsnormen vornimmt, wo dann rauskommt, welche Art Demokratie wir haben; dieser Prozess ist ungemein wichtig. Und die Frage ist, wie weit voneinander weg sind heute unsere Verfassung und unser Alltagsleben.
Auf Herausforderungen des gesellschaftlichen Zusammenhalts antwortete die Sozialdemokratie stets mit sozialer Gerechtigkeit. In ganz Europa aber beobachten wir das Schwinden der sozialdemokratischen Parteien. Hat die SPD noch Zukunft?
Eine Kollege schrieb jüngst, die SPD solle sich bei 20 Prozent einrichten, oder aber wieder einmal ordentliche linke Politik machen. Eine andere Diskussionsrichtung geht dahin, dass man sagt, eigentlich müssten die Sozialdemokraten eine liberale Partei werden. Mit Tony Blair und Gerhard Schröder gab es ja schon mal so eine Tendenz. Das würde heißen, dass man versucht, die soziale Frage über die Bildung zu regeln, dass man in das Bildungssystem investiert, und zwar von Kindesbeinen an. Aber das muss man nicht nur so sagen, die SPD müsste das tatsächlich auch machen.
Hat die SPD nach Ihrer Beobachtung überhaupt eine Idee,was sie jetzt machen soll?
Die Kernfrage ist, wo befindet sich ihre Klientel? Ich meine, im Industrialisierungsprozess waren das die Fabrikarbeiter. Da konnten sie sich organisieren, hatten starke Gewerkschaften und die SPD als politischen Arm. Heute gibt es diese Art von Industriearbeiterschaft nicht mehr. Heute gibt es auch Großkonzerne, aber die Arbeitswelt ist eine ganz andere geworden. Das heißt, die Unsicherheiten, die die SPD immer politisch abzusichern versucht hat, treten nunmehr viel individualisierter auf. Wie organisiert man heute diejenigen, die nicht so selbstbewusst und stark sind? Die Modernisierungsverlierer? Es gibt kein Patentrezept. Aber die Schwäche der Organisationsfähigkeit der Sozialdemokratie ist eklatant. Da muss etwas geschehen.
Wie organisiert man heute diejenigen, die nicht so selbstbewusst und stark sind?
Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es eine Diskussionskultur in der sozialdemokratischen Linken gibt, die so weit weg ist von dem, was Leute heute als wirklich wichtig empfinden. Also zum Beispiel die Gender-Debatte. Die Frage, wie viele Geschlechter es denn nun gibt. Auf welche Toilette man nun gehen soll und was damit für politische Probleme verbunden sind. Das sind Fragen, wo heute viele SPD-Wähler einfach nur noch den Kopf schütteln und sagen: Gibt es denn nicht wichtigere Probleme? Es gibt eben die Klientel, die auf den Flughäfen ihre Vielfliegerkarte zückt, und die, die im ländlichen Raum noch immer kein schnelles Internet hat.
Unisex-Toiletten sind auch ein später Ausdruck des Wertewandels, also der „Silent-Revolution“ im Sinne Ronald Ingleharts. In unseren Tagen spricht Inglehart von kultureller Gegenreaktion und weist damit auf den Aufstieg der rechtspopulistischen Parteien hin.
Also die AfD hat sicherlich viele Mütter und Väter, unter anderem die Flüchtlingsfrage, eine ganz komplizierte Geschichte. Zunächst aber noch einmal zu den Werten. Am Anfang stehen ja immer Personen, damals zum Beispiel die Suffragetten, die etwas Neues thematisieren. Und am Anfang des Prozesses werden diese Personen als abgehoben und nicht dem Mainstream zugehörig wahrgenommen. Es braucht aber solche Kerne, um die Prozesse in Gang zu setzen, um Werte zu realisieren. Aber ich glaube, da gibt es einen Breaking-Point, wo man die Leute nicht mehr mitnehmen kann, besonders wenn man das akademisiert! Nehmen wir die Geschlechterfrage. Wenn man nicht mehr von Männern und Frauen sprechen kann, sondern nur noch stets im Zusammenhang mit den vielen anderen Möglichkeiten, dann verliert man den Anschluss an den Mainstream der Gesellschaft. Da tut man auch der Sache selbst keinen Gefallen. Die Ökonomen würden sagen: Diminishing Marginal Utility. Es bringt einfach nur einen marginalen Ertrag. Natürlich darf man solche Entwicklungen nicht vernachlässigen, aber man muss sich doch überlegen, mit welcher Intensität und Breite man das als Volkspartei in den Mittelpunkt der programmatischen Überlegungen stellt. Da macht die SPD sicherlich einen Fehler.
Was sind Faktoren für den Erfolg der Rechtspopulisten?
Es gibt einen Erklärungsstrang für den Erfolg von Trump in den USA, der mich überzeugt hat und der etwas mit Identität zu tun hat. Durch den industriellen Wandel hat sich im sogenannten Rust Belt ein ökonomischer Wandel vollzogen, der viele Leute, die früher in der Kohle oder in der Stahlindustrie gearbeitet haben, arbeitslos zurückgelassen hat.
Wohin wird sich die AfD entwickeln?
Und die Demokraten haben bei jeder neuen Wahl versprochen: Jetzt wird das alles ganz anders und jetzt machen wir was für euch. Was mich dabei erschüttert hat: Hillary Clinton und „die in Washington“ haben von diesen Leuten, die immerhin die Demokratische Partei treu, Wahl für Wahl, bis auf die Trump-Wahl, unterstützt hatten, als „white trash“ gesprochen. Das hat diese Leute ins Mark getroffen. Wenn man überhaupt noch ein gewisses Selbstwertgefühl behalten will und die Partei, die man immer gewählt hat, sagt jetzt „You are the white trash!“, das geht zu weit! Damit haben sie die Leute in ihrem Selbstwertgefühl zu sehr verletzt. Ich glaube, wenn die Demokraten versucht hätten, den Strukturwandel zu steuern, dann wären viele Wähler auch bei der Stange geblieben. Aber diese Menschen von Wahl zu Wahl einfach zu ignorieren und dann auch noch so über sie zu reden? Auch die AfD hat etwas aufgegriffen, was die anderen Parteien vernachlässigt haben. Sie haben viele der Sorgen und Ängste dieser Leute artikuliert. Warum ist die AKP in der Türkei stark geworden? Zum großen Teil deshalb, weil die Kemalisten die Mitbürger, die vom Land in die großen urbanen Zentren gewandert sind, ignoriert haben. Die wenigen, die sich um diese Leute gekümmert haben, waren AKP-nahe Imame. Wenn man bestimmte Gruppen an sich binden will und auch die generelle Ideologie hat, den Bedürftigen und Ärmeren in der Gesellschaft zu helfen, dann muss man das auch machen. Dann kann man das nicht nur immer vor sich hertragen, sondern man muss es machen. Und daran fehlt es, glaube ich, auch bei diesem Problem.
Mit dem Thema rechter Radikalisierung haben Sie sich bereits vor rund 50 Jahren gemeinsam mit Erwin K. Scheuch in einem bemerkenswerten Aufsatz1 auseinandergesetzt. Sind die heutigen Probleme aus Ihrer Sicht eigentlich anderer Art als damals?
Ich denke, die generellen Elemente der Theorie kann man auch heute noch mit Gewinn verwenden. Es gibt immer eine psychologische Komponente, und es gibt die Makro-Komponente der gesellschaftlichen Veränderungen, die sich vor allem im Fortschritt der Technik und in den daraus resultierenden Umbrüchen in der Arbeitswelt manifestieren. Und es gibt dann die daraus resultierenden Konflikte, die einerseits von den Individuen selbst und andererseits von gesellschaftlichen Gruppierungen – in der Regel von Organisationen – ausgetragen werden. Die Frage ist: In welchem Maß und wie organisieren sich die Bürger, die sich bedroht fühlen und dem politisch entgegenwirken möchten? Oder Bürger, denen es gut geht, die aber ihre Rente sichern wollen. Oder die Reichen, die immer reicher werden. Ich habe gerade gelesen: Auf jeden Abgeordneten im amerikanischen Kongress kommen drei Lobbyisten der Finanzindustrie, die dafür sorgen, dass in der amerikanischen Gesetzgebung diejenigen, die das meiste Geld verdienen, ihren Teil am Unterhalt des Gemeinwesens nicht angemessen bezahlen. Mitt Romney hat danach weniger Steuern bezahlt als seine Sekretärin. Diese ökonomischen Ungleichheiten sind wichtig. Das haben wir in unserer Theorie natürlich auch berücksichtigt. Aber wir haben noch darüber hinaus versucht, Konfliktstruktur und Organisation mit der dabei einhergehenden Ideologie zu verbinden. Und wir haben in den rechten Ideologien einen Kern gefunden, den wir mit „Verklärung der Vergangenheit“ bezeichnet haben. Also, da war immer die schöne alte Welt, die man wiederherstellen wollte, um die Sicherheit, die man dort empfunden hat, wiederzugewinnen. Weil das so einfach nicht möglich ist, ist die Frustration angelegt.
Welche ist denn die schöne, verklärte Welt der AfD-Leute? Sind das die 1950er Jahre? Oder die 1980er Jahre?
Ich denke, das ist nach den Generationen verschieden. Die Tendenz geht dahin, dass die Zeitläufe verklärt werden, in denen man sich selbst entwickelt oder wo man im Beruf und in der Familie positiv-prägende Erfahrungen gemacht hat.
Sie haben damals auch etwas geschrieben, das heute sehr aktuell ist. Extreme politische Angebote würden zunächst von Personen mit rigider Orientierung begrüßt. Werden aber die Extreme im politischen Diskurs immer konventioneller und hoffähiger gemacht, dann werden sie auch immer mehr für Personen ohne rechtsradikale Orientierung attraktiv oder wählbar.
Ja! Aber es geht nicht nur um Ideologien und Weltsichten, sondern diese Ideologien und Weltsichten kommen relativ schnell immer an einen Punkt, wo sich die Leute dann fragen, funktioniert das auch? Also, es muss mittel- oder langfristig dann schon ein Erfolg in der politischen Umsetzung da sein. Und wenn solche Populisten wie Trump etwa bestimmte Versprechungen im Wahlkampf machen und versuchen, diese umzusetzen, dann kommt irgendwann die Stunde der Wahrheit. Die Frage ist: Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und die Bürger sind meistens viel schlauer, als die Politiker sie haben wollen. Die merken das, wenn es nicht funktioniert. Dann werden sie versuchen, ihre Situation in anderer Weise zu verbessern.
Die Unterstützung für rechtspopulistische Parteien ist in den letzten Dekaden deutlich gestiegen, das ist ein gesamteuropäisches Phänomen. In Deutschland ist die AfD 2017 mit einem beachtlichen Ergebnis in den Bundestag eingezogen. Was spricht heute dafür, dass die AfD nicht nur eine vorübergehende Erscheinung ist?
Also, ich bin mir da über die Richtung noch nicht hundertprozentig sicher. Auf der einen Seite sage ich mir, nach 1945 ist Deutschland immer eine Ausnahme gewesen, was die rechte Seite des Parteiensystems angeht, wegen unserer Vergangenheit. Das heißt, es hat sich im Grunde genommen keine konservative Partei etablieren können. Es haben sich zwei kollektivistisch orientierte Parteien als Volksparteien etabliert, die CDU (CSU) und die SPD. Die CDU mit den Werten von Rerum Novarum², das heißt stark beeinflusst von der katholischen Soziallehre. Und die SPD in der Tradition einer sozialistisch orientierten Partei. So hatte sich das nach dem Zweiten Weltkrieg herausgebildet. Die beiden Flügel der FDP überlebten in Nordrhein-Westfalen und im Südwesten. Aber auf der rechten Seite hatte es weder die Deutsche Partei noch irgendeine der vielen kleinen „rechten“ Parteien, die alle wieder eingegangen sind, geschafft, sich einen Platz im deutschen Parteiensystem zu sichern. Die Frage ist also: Wird aus der AfD eine konservative oder eine rechtsextreme Partei? Das wird die AfD selber entscheiden müssen. Sie beherbergt gegenwärtig beide Flügel. Den extremistischen Flügel, angeführt von Funktionären wie Herrn Höcke, und den konservativen Flügel, für den Herr Gauland steht, der, zumindest in früheren Tagen, fähig war, konservative Positionen zu formulieren. Die Frage ist, welches politische Programm sich diese Partei letzten Endes geben wird. Die Frage ist auch, wird sie für Koalitionsbildungen gebraucht. Ich erinnere mich an DIE GRÜNEN in den 1980er Jahren. DIE GRÜNEN waren auch einmal die Schmuddelkinder der Nation, keiner wollte mit ihnen spielen. Was haben sie gemacht? Sie haben etwas ganz Schlaues gemacht. Sie haben in ihre Organisation investiert. Organisation aufbauen, braucht Geld. DIE GRÜNEN haben der Organisationsfrage vor allem nach der Europawahl 1983 Priorität eingeräumt. Sie haben die Mittel, die sie im Rahmen der Parteienfinanzierung bekommen haben, in den Aufbau ihrer Organisation gesteckt. Das heißt, damit haben sie Ortsvereine gestärkt und organisiert. Ist die AfD gleichermaßen so aufgestellt, dass sie die Mittel, die sie hat, in die Organisation steckt? Wenn die das macht, dann ist sie auf eine gewisse Dauer erst mal da. Dann ist es nicht nur ein Lüftchen, das über das deutsche Parteiensystem weht. Sie hat dann Organisationskerne. Sie hat dann immer auch Mitglieder, die sagen: Wir stehen für organisierte Interessen. Wir wollen Leute in den Bundestag.
Der seinerzeit vielbeschriebene Prozess „von der Bewegung zur Partei“. Damals bei den GRÜNEN – jetzt bei der AfD?
Ich denke, die Flüchtlingsfrage war ein Auslöser, gerade für Leute am konservativen Rand der CDU/CSU. Die Öffnung der Grenzen, der Kontrollverlust des Staates, dann ein kultureller Reflex gegen den Islam, also eine religiöse Dimension, die auch untrennbar mit den Neuorientierungen verbunden ist. Und die AfD hat ja eine einfache Antwort auf diese Fragen gegeben. So einfach, wie die AfD es sich vorstellt, kann man die Probleme nicht lösen. Man wird sehen. Wenn ich morgens mit dem rechten Fuß aus dem Bett steige, dann denke ich, vielleicht hat die List des Parteienwettbewerbs das deutsche Parteiensystem durch eine konservative Partei gestärkt. Und wenn ich mit dem linken Fuß aus dem Bett steige, dann denke ich mir: Mein Gott, dass ich in meinen Lebzeiten noch eine rechtsextreme Partei ertragen muss.
Quellen:
¹ Erwin K. Scheuch und Hans-Dieter Klingemann (1967): Theorie des Rechtsradikalismus in westlichen Industriegesellschaften, in: Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, S. 11-29.
² Sozialenzyklika von 1891 unter Papst Leo XIII., ein grundlegendes Dokument der katholischen Soziallehre.
Zum Weiterlesen:
Christian Welzel, Ronald Inglehart und Hans-Dieter Klingemann (2003): The Theory of Human Development: A cross-cultural analysis, in: European Journal of Political Research, 42: 341-379.
Pippa Norris und Ronald Inglehart (2018): Cultural Backlash: Trump, Brexit and the Rise of Authoritarian Populism, New York (Cambridge University Press, im Erscheinen).
Pierre Ostiguy (2017): Populism. A SocioCultural Approach, The Oxford Handbook of Populism (Eds.: Cristobal Rovira Kaltwasser, Paul Taggart, Paulina Ochoa Espejo and Pierre Ostiguy), Oxford, 73-97.